Tax & Law Magazine
Das Kundenmagazin von EY Deutschland zu aktuellen Steuer- und Rechtsthemen. Das kostenfreie Magazin erscheint vierteljährlich und richtet sich an Führungskräfte sowie Leiter der Steuer-, Finanz- und Rechtsabteilungen der deutschen Wirtschaft.
Direkt in Ihren Briefkasten
Tragen Sie hier Ihre Postadresse ein, um Teil unseres exklusiven Leserkreis zu werden.
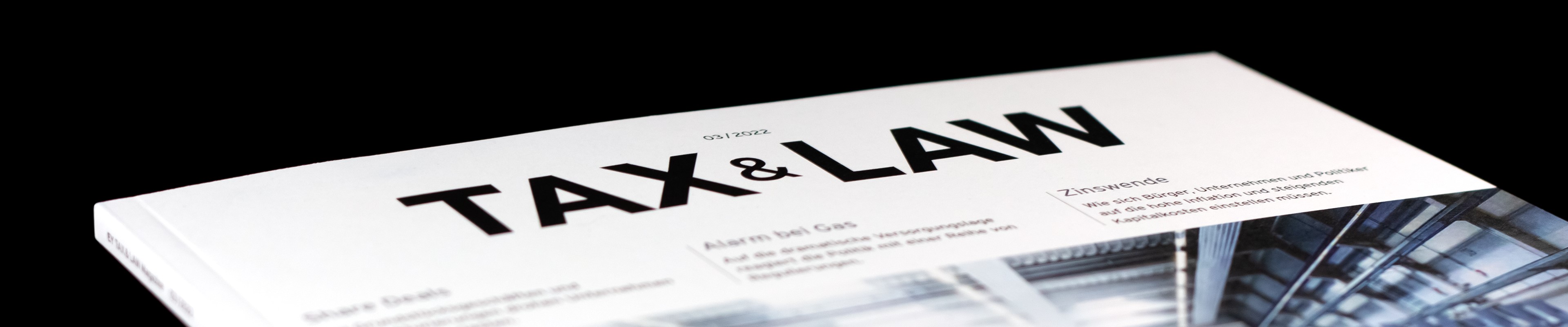
Letzte Suchabfragen
Perspektiven
Redaktionsteam
Kontaktieren Sie uns
Neugierig geworden? Schreiben Sie uns.
Herausgeber
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Flughafenstraße 61
70629 Stuttgart
Redaktion Alexander Reiter, Daniel Käshammer, Dr. Andreas Bolik, Nico Schönberg, Sophia Schuhmann
Gestaltung Fuenfwerken Design AG, Wiesbaden / Berlin
Druck Druckhaus Sportflieger




