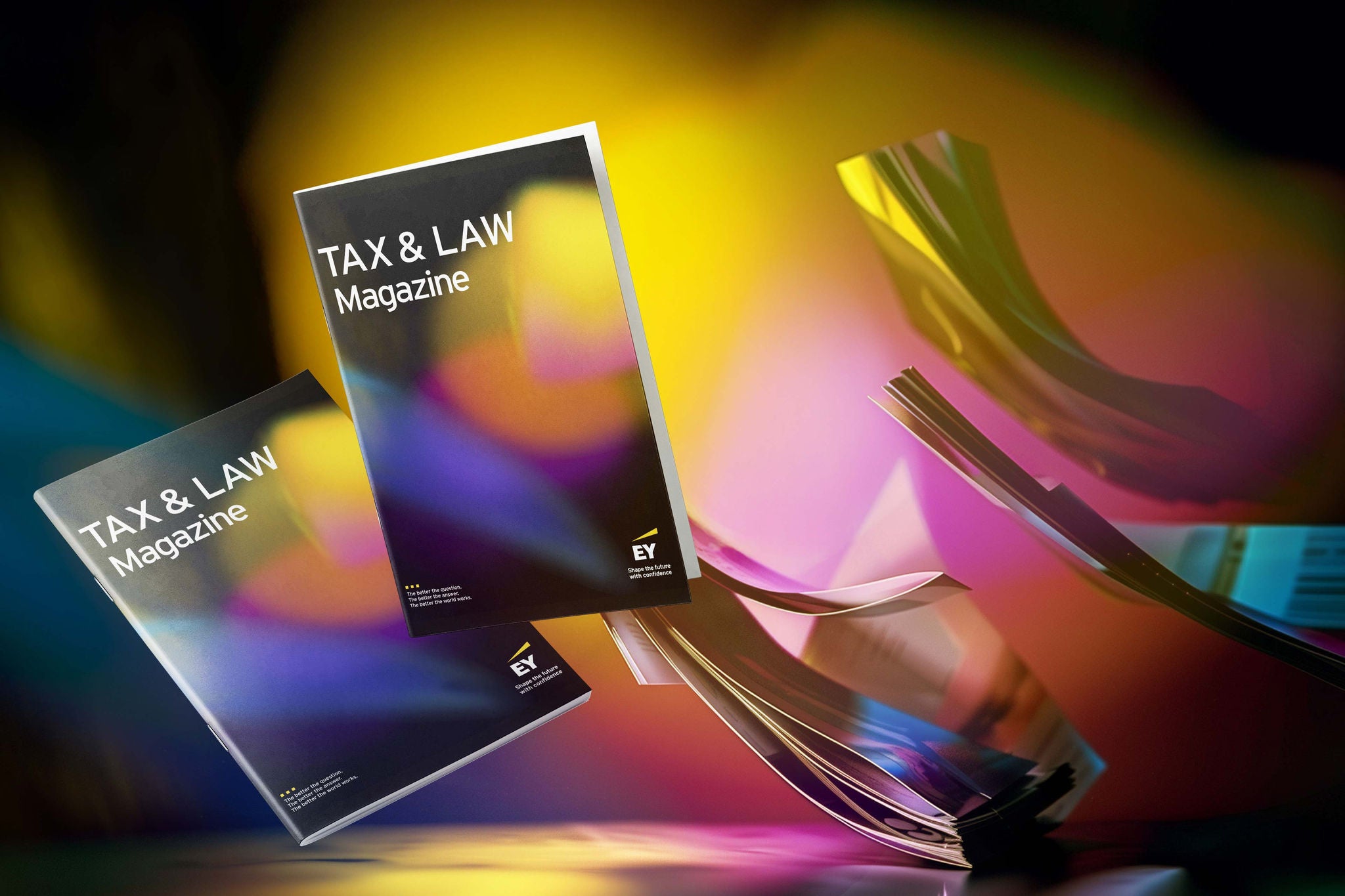Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden.
So unterstützen wir Sie
-
Unsere Fachkolleginnen und -kollegen für indirekte Steuern können Ihr Unternehmen dabei unterstützen, Risikobereiche innerhalb des gesamten Steuerlebenszyklus zu identifizieren und nachhaltige Planungsmöglichkeiten zu entwickeln. Erfahren Sie mehr.
Mehr erfahren
Welche Alternativen gibt es zur Zwischenbankbefreiung ab 2025?
Durch den Wegfall der Zwischenbankbefreiung sollten betroffene Unternehmen aktiv werden, um künftige steuerliche Nachteile zu vermeiden. Dabei stehen unter anderem folgende Optionen zur Verfügung, deren Anwendung in Anbetracht der Komplexität der Regelungen aber einer detaillierten Einzelfallanalyse bedarf:
1. Nutzung der Zusammenschlussbefreiung
Die Zusammenschlussbefreiung nach § 6 Abs. 1 Z 28 UStG bleibt auch nach dem 01.01.2025 in Kraft. Nach nationalem Umsatzsteuerrecht können folglich sonstige Leistungen von Zusammenschlüssen an ihre Mitglieder weiterhin umsatzsteuerfrei verrechnet werden, soweit diese Leistungen unmittelbar zur Ausführung begünstigter Umsätze verwendet werden und die Verrechnung nach dem Prinzip der genauen Kostenerstattung erfolgt.
Auch die Herstellung von Zusammenschlüssen über mittelbare Beteiligungen bleibt möglich, sofern an der direkt am Zusammenschluss beteiligten Gesellschaft selbst nur Unternehmer, die überwiegend Bank-, Versicherungs- oder Pensionskassenumsätze tätigen, beteiligt sind. Ein Mindestbeteiligungsmaß besteht nicht. Die Verrechnung durch den Zusammenschluss sollte auch bei mittelbarer Beteiligung direkt an die leistungsempfangenden begünstigten Unternehmer erfolgen. Eine mittelbare Beteiligung wäre auch über einen zweiten Zusammenschluss denkbar, der am leistenden Zusammenschluss beteiligt ist.
Nicht mehr möglich ist seit 01.01.2025 die steuerfreie Leistungsverrechnung zwischen Zusammenschlüssen, da diese auf der Zwischenbankbefreiung basierte. Soweit Zusammenschlüsse Leistungen von anderen Zusammenschlüssen beziehen und an ihre Mitglieder weiterverrechnen, kommt es ab 01.01.2025 zu höheren Kosten, welche infolge des Gebots der reinen Kostenverrechnung von den Zusammenschlussmitgliedern zu tragen sind.
Ebenfalls mit Kostenerhöhungen für leistungsempfangende Zusammenschlussmitglieder verbunden ist der Wegfall der Steuerbefreiung für Personalgestellungen an Zusammenschlüsse ab 01.01.2025, da die nunmehr anfallende und nicht als Vorsteuer abziehbare Umsatzsteuer im Wege der Kostenverrechnung an die leistungsempfangenden Zusammenschlussmitglieder weiter zu verrechnen ist.
2. Organschaft und Insourcing als strategische Optionen
Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung von Vorsteuerschäden besteht in der Bildung von Organschaften sowie der Hereinverlagerung von Leistungserstellungsprozessen („Insourcing“) in das eigene Unternehmen etwa durch Einschaltung leistungserbringender – auch ausländischer – fester Niederlassungen.
Erst kürzlich wurde vom EuGH (11.07.2024, Rs C-184/23, Finanzamt T II) die bereits bis dato in Österreich vorherrschende Auffassung, wonach Organschafts-Innenumsätze nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, bestätigt. Der EuGH führt dabei auch aus, dass gegen Entgelt erbrachte Leistungen zwischen Personen, die ein und derselben Mehrwertsteuergruppe angehören, selbst dann nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn der Empfänger der Leistung nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Besonders herausfordernd ist bei Vorliegen einer Organschaft die umsatzsteuerliche Beurteilung von Leistungsbezügen von ausländischen festen Niederlassungen, sie bedarf in der Praxis einer genauen Auseinandersetzung mit der hierzu einschlägigen EuGH-Judikatur (17.09.2014, Rs C-7/13, Skandia America bzw EuGH 11.03.2021, Rs C-812/19, Danske Bank).
3. Prüfung der Anwendbarkeit anderer Steuerbefreiungen sowie Analyse der Auswirkungen auf den Vorsteuerschlüssel
Viele Banken, Versicherungen und Pensionskassen haben in der Vergangenheit nicht geprüft, ob neben der Zwischenbankbefreiung auch andere Steuerbefreiungen auf bestimmte Umsätze anwendbar gewesen wären. Angesichts des potenziellen Durchführungsverbots und möglicher Beihilfe-Rückforderungen ist diese Prüfung nun jedoch – ausdrücklich auch rückwirkend – dringend geboten. Sollte sich herausstellen, dass bestimmte Umsätze auch unter eine andere Steuerbefreiung fallen, wären diese nicht von einer etwaigen Beihilfe-Rückforderung betroffen.
Gleichzeitig müssen Unternehmen analysieren, wie sich die Streichung der Zwischenbankbefreiung auf den anwendbaren Vorsteuerschlüssel auswirkt.